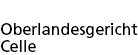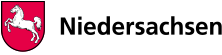Allgemeine Hinweise zum Verfahren auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses nach § 1309 BGB
Inhalt:
- Was ist ein Ehefähigkeitszeugnis
- Wo und wie ist der Befreiungsantrag zu stellen?
- Wo erhalte ich Auskünfte zu dem bzw. meinem Befreiungsverfahren?
- Wie lange dauert das Verfahren?
- In welcher Form müssen die Urkunden vorgelegt werden?
- Wie alt dürfen die Urkunden sein?
- Welche Anforderungen müssen Übersetzungen erfüllen?
- Welche Identitäts- und Staatsangehörigkeitsnachweise sind vorzulegen?
- Wann müssen Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge & heimatlose Ausländerinnen und Ausländer keine Befreiung beantragen?
- Welche Unterlagen müssen in Bezug auf Wohnsitz und Familienstand vorgelegt werden?
- Welche Angaben müssen zu Vorehen gemacht werden?
- Welche Kosten entstehen für das Befreiungsverfahren?
1. Was ist ein Ehefähigkeitszeugnis?
Nach Art. 13 Absatz 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) unterliegen die Voraussetzungen der Eheschließung für jeden Verlobten (Eheschließenden) dem Recht des Staates, dem er/sie angehört.
Wer hinsichtlich der Eheschließung ausländischem Recht unterliegt, soll gemäß § 1309 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) eine Ehe nicht eingehen, bevor er/sie ein Zeugnis der inneren Behörde seines Heimatstaates darüber beigebracht hat, dass der Eheschließung nach dem Recht dieses Staates kein Ehehindernis entgegensteht (sog. Ehefähigkeitszeugnis).
Angehörige von Staaten, die ein solches Ehefähigkeitszeugnis nicht ausstellen, können nach § 1309 Absatz 2 BGB auf Antrag durch die Präsidentin bzw. den Präsidenten des Oberlandesgerichts von dem Erfordernis der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses befreit werden.
Das Oberlandesgericht prüft dabei aus Sicht der ausländischen Behörde, ob der beabsichtigen Eheschließung nach dem Heimatrecht ein Hindernis entgegensteht.
2. Wo und wie ist der Befreiungsantrag zu stellen?
Das Befreiungsverfahren setzt zunächst die Anmeldung der Eheschließung bei dem zuständigen Standesamt voraus.
Dort ist auch der Antrag auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses zu stellen. Der Befreiungsantrag ist durch das zuständige Standesamt in einer Niederschrift (Antragsvordruck) aufzunehmen und die Entscheidung über den Antrag vorzubereiten (§ 12 Absatz 3 des Personenstandsgesetzes (PStG)). Eine Vertretung bei der Antragstellung durch eine Bevollmächtigte oder einen Bevollmächtigten ist möglich. In diesem Fall ist die Vorlage einer Originalvollmacht erforderlich. Hierbei ist nach Möglichkeit das zum Download zur Verfügung gestellte Formular „Vollmacht“ zu verwenden.
Das Standesamt übersendet den Vorgang im Anschluss zur Entscheidung über die Befreiung an das Oberlandesgericht. Das Oberlandesgericht Celle ist für die Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses zuständig, wenn die Eheschließung bei einem Standesamt innerhalb des Bezirks des Oberlandesgerichts Celle angemeldet wurde.
Zur Vorbereitung der Anträge durch das Standesamt gelten die folgenden allgemeinen Hinweise zu 3. bis 12.
3. Wo erhalte ich Auskünfte zu dem bzw. meinem Befreiungsverfahren?
Informationen über das Eheschließungsverfahren des Standesamts und das Befreiungsverfahren beim Oberlandesgericht erteilt das Standesamt. Auch Auskünfte über den Stand des Verfahrens sind beim Standesamt einzuholen.
Eine persönliche Vorsprache der Verlobten oder Dritter bei den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern des Oberlandesgerichts ist nicht erforderlich, um eine zügige und kontinuierliche Bearbeitung aller Anträge beim Oberlandesgericht in der Reihenfolge des Eingangs zu gewährleisten.
4. Wie lange dauert das Verfahren?
Die Bearbeitungsdauer beträgt in der Regel 3 bis 8 Wochen. Im Einzelfall kann sich die Verfahrensdauer wegen Beanstandungen (z. B. wegen fehlender Urkunden) oder aufgrund ggf. erforderlichen Einsichtnahme in die Ausländerakten verlängern. Wir bitten um Ihr Verständnis!
5. In welcher Form müssen die Urkunden vorgelegt werden?
Sämtliche Urkunden sind dem Antrag grundsätzlich im Original beizufügen, sofern nicht im Herkunftsland ausnahmsweise nur eine elektronische Erstellung vorgesehen ist.
Das Standesamt erteilt zudem Auskunft darüber, in welcher Form (z.B. mit Apostille oder Legalisation) die Urkunden verwendungsfähig sind.
Die Originale der Urkunden sind grundsätzlich mit der Legalisation der zuständigen deutschen Auslandsvertretung oder mit der Apostille der zuständigen ausländischen Heimatbehörde versehen vorzulegen. Mehrsprachige Urkunden, die von einem der Vertragsstaaten nach dem Muster der Übereinkommen der Internationalen Kommission für das Zivil- und Personenstandswesen (CIEC) ausgestellt werden, sind in Deutschland von jeder Förmlichkeit befreit.
Die inhaltliche Überprüfung von ausländischen Urkunden ist bei Staaten erforderlich, in denen die Voraussetzungen zur Legalisation nicht gegeben sind. Sie erfolgt im Rahmen der Amtshilfe durch die zuständige deutsche Auslandsvertretung. Diese Überprüfung wird ggf. vom Standesamt veranlasst.
6. Wie alt dürfen die Urkunden sein?
Zum Nachweis des Familienstandes müssen aktuelle urkundliche Nachweise vorgelegt werden, die nicht älter als 6 Monate sein dürfen.
Die Frist von 6 Monaten wird von der Ausstellung der Urkunden bis zur Vorlage beim Standesamt gerechnet. Aufgrund einer im laufenden Eheschließungs- oder Befreiungsverfahren nachträglich geforderten Legalisation der Urkunden oder sonstiger noch zu erfüllender Auflagen ist der Ablauf der 6-Monats-Frist im Einzelfall dann unschädlich, wenn die Eheschließenden das Eheschließungsverfahren zügig und ohne Unterbrechung betrieben haben.
7. Welche Anforderungen müssen Übersetzungen erfüllen?
Übersetzungen sind nach § 142 Absatz 3 der Zivilprozessordnung (ZPO) in Verbindung mit den §§ 107 ff. des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) grundsätzlich von einem/einer in der Bundesrepublik Deutschland amtlich zugelassenen und beeidigten Urkundenübersetzerin oder Urkundenübersetzer zu fertigen.
Der fremdsprachige Text ist von der Ursprungssprache direkt – ohne „Zwischenübersetzung“ in eine andere Sprache – in die deutsche Sprache zu übersetzen.
Ausnahmen gelten für sog. internationale mehrsprachige Urkunden und Übersetzungen von Urkunden, die aus der Europäischen Union stammen. Bei Fragen wenden Sie sich ggf. an Ihr Standesamt.
8. Welche Identitäts- und Staatsangehörigkeitsnachweise sind vorzulegen?
In dem Befreiungsverfahren haben ausländische Staatsangehörige zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Staatsangehörigkeit grundsätzlich eine amtlich beglaubigte Ablichtung ihres gültigen Reisepasses (Auslandspass) vorzulegen.
Bürgerinnen und Bürger aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die nicht über einen Reisepass verfügen, können ihre Identität mit einer beglaubigten Kopie des ausländischen Personalausweises belegen.
Bei deutschen Staatsangehörigen ist die Vorlage einer beglaubigten Kopie des Personalausweises ausreichend.
9. Wann müssen Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge & heimatlose Ausländerinnen und Ausländer keine Befreiung beantragen?
In der Bundesrepublik Deutschland anerkannte Asylberechtigte, ausländische Flüchtlinge nach § 60 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes (bzw. § 51 Absatz 1 des Ausländergesetzes a.F.) und heimatlose Ausländerinnen und Ausländer unterliegen dem deutschen Personalstatut, wenn sie ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Sie müssen für eine beabsichtige Eheschließung kein Ehefähigkeitszeugnis vorlegen und bedürfen auch keiner Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses.
Dem Antrag sind für beide Eheschließenden aktuelle Aufenthaltsbescheinigungen des deutschen Meldeamts mit ausdrücklicher Angabe des Familienstandes beizufügen, sofern sie ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Vorlage sog. Meldebescheinigungen ohne Angabe des Familienstandes sind nicht ausreichend. Unmittelbar vor Antragstellung eingetretene Veränderungen des Familienstandes sind durch das Meldeamt zu berichtigen.
Für ausländische Verlobte, die sich noch im Ausland aufhalten und in Deutschland nicht gemeldet sind, ist die einfache Angabe des Wohnsitzes im Antrag ausreichend.
Außerdem haben sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhaltende ausländische Verlobte ihren ausländerrechtlichen Aufenthaltsstatus durch die Vorlage eines gültigen Aufenthaltstitels (z.B. Niederlassungserlaubnis, Duldung, Visum, etc.) nachzuweisen. Personen mit der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (sog. Unionsbürgerinnen und Unionsbürger) benötigen wegen des geltenden Freizügigkeitsrechts keinen besonderen Nachweis über die Aufenthaltsberechtigung in der Bundesrepublik Deutschland.
11. Welche Angaben müssen zu Vorehen gemacht werden?
In dem Befreiungsantrag sind grundsätzlich alle Vorehen der Verlobten sowie deren Auflösung anzugeben.
Die wirksame Auflösung der letzten Vorehe ist durch Vorlage entsprechender Nachweise zur Auflösung (z. B. Sterbeurkunde, Abschrift aus dem Eheregister oder Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk) nachzuweisen. Ist die letzte Ehe nicht bei einem deutschen Standesamt geschlossen worden, so ist auch die Auflösung etwaiger weiterer Vorehen nachzuweisen.
12. Welche Kosten entstehen für das Befreiungsverfahren?
Für Verfahren zur Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses ist eine Rahmengebühr zwischen 15,00 € und 305,00 € zu erheben (Nr. 1330 des Kostenverzeichnisses zu § 4 Abs. 1 JVKostG).
Die Höhe der Kosten richtet sich u. a. nach der Bedeutung der Angelegenheit für die Beteiligten, dem Umfang und der Schwierigkeit des Verfahrens sowie den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Verlobten.
Daher sind mit dem Antrag von beiden Verlobten Angaben über das aktuelle monatliche durchschnittliche Netto-Einkommen (in €) zu machen. Einkommensnachweise können nachgefordert werden.